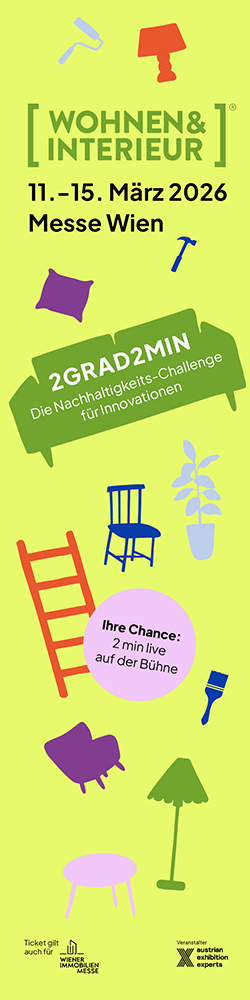Aufzug der Automaten
Im Betonbau und bei Holz ist die industrielle Fertigung Standard. Im Ziegelbau entwickeln sich neue Ansätze nicht rasant aber doch.
Nach rund drei Jahren Entwicklungszeit war es Ende November des Vorjahres soweit. wienerberger präsentierte als erstes Unternehmen in Europa einen neuen Mauerwerksroboter. Der Maurer ohne Lohnnebenkosten, Krankenstand und Urlaub nennt sich WLTR, wurde in Tschechien entwickelt und errichtet Ziegelmauern von über drei Metern Höhe mit einer Leistung von durchschnittlich 5-6 m²/Stunde. Eingesetzt werden soll er vor allem für den Bau von Industriebauten und Mehrfamilienhäusern. „Die Bauindustrie steht in Zeiten der Digitalisierung, der hohen Nachfrage nach leistbarem Bauen und Wohnen, dem vorherrschenden Fachkräftemangel und dem Ziel, die oftmals körperlich schweren Tätigkeiten am Bau zu erleichtern, vor großen Herausforderungen“, sagt Johann Marchner, Country Managing Director von wienerberger Österreich. Sein Unternehmen sieht sich als Innovationsführer in der Branche und ortet großes Potenzial in der Automatisierung, Vorfertigung und Robotik, um Bauvorhaben schneller und günstiger zu realisieren „Und das wird uns künftig mithilfe von WLTR gelingen“, ist Marchner überzeugt. Es ist nicht der erste Roboter, den wienerberger präsentiert. Der Vorgänger nannte sich Hadrian X und mauerte bereits 2019 testweise. Zuletzt mauerte Hadrian 2022 im australischen Wellard erstmals mit Porotherm-Ziegeln von Wienerberger ein komplettes Wohnhaus.
Nun mauert also WLTR, dieser Roboter wurde für den Prozess des Ziegellegens konzipiert. Er arbeitet drinnen als auch draußen unter minimaler menschlicher Aufsicht, benötigt zur Bedienung lediglich Wasser und Strom und reduziert die körperliche Belastung der Maurer auf der Baustelle erheblich. Der Mauerwerksroboter soll den Bau durch die Integration einer ausgeklügelten digitalen Plattform pushen. Der Roboter generiert umfangreiche Metadaten, welche die Bauqualität und die Dokumentation sichern und er optimiert Bestellungen, Logistik und das Baustellenmanagement, so wienerberger. Aktuell sind sieben Roboter verfügbar, die von Bauunternehmen angemietet werden können. In den kommenden Jahren sollen weitere Modelle hinzukommen. Die laufende Entwicklung von WLTR verspricht, weitere fortschrittliche Funktionen zu integrieren, die ihn für ein breiteres Anwendungsspektrum, einschließlich Wohngebäuden, geeignet machen.
Integrierte Fenster-Elemente
Im Einfamilienhaus fix verankert ist unterdessen das Familienunternehmen Etzi aus Ried im Traunkreis (OÖ). Mit den Marken „Etzi“ und „Austrohaus“ ist das Unternehmen österreichischer Marktführer für belags- und schlüsselfertige Häuser in Ziegelmassivbauweise. Damit das so bleibt, hat der Firmengründer Maximilian Etzenberger mit einer Investitionssumme von 40 Millionen Euro eben erst einen Meilenstein in der 32-jährigen Geschichte des Unternehmens gesetzt. Mitte Jänner wurde die sogenannte Etzi-World, der neue Firmensitz, offiziell eröffnet. Ein Großteil der rund 250 Etzi-Beschäftigten ist dort nun untergebracht. Und in einer Halle werden vollautomatisch sogenannte Wallment-Ziegelfertigwände gefertigt. Wallment ist eine Fertigwand mit einem bereits integrierten Windowment-Element und erhältlich in Wandstärken von 12 bis 50 cm. Die Ziegelwand wird mit der weltweit modernsten, vollautomatischen Fertigungsanlage am Standort produziert, so Etzenberger. Durch den Einsatz der im Werk vorgefertigten Systemelemente verkürzt sich nicht nur die Bauzeit, sondern auch die Personal- und Baukosten würden dadurch reduziert. Die vorgefertigten Komplettlösungen ermöglichen die trockene, schnellere, kosteneffizientere sowie nachhaltigere Umsetzung von Bauprojekten, so der Baupionier. Die Stoßrichtung der Ziegelfraktion ist klar, das Bauen muss schneller und günstiger werden. Die gestiegenen Bau- und Materialkosten und der Mangel an willigen und billigen Arbeitskräften zwingen die Branche zur Modernisierung. Als Treiber fungiert auch die bei Bauherr:innen zunehmend gefragte Alternative Holz. Kurzum, seitdem sich der Baustoff Holz, unterstützt mit viel Fördergeld, zunehmend den Weg auf die Baustellen gebahnt hat, führt für andere Gattungen kein Weg daran vorbei, modular zu denken und die Vorfertigung zu forcieren.
Maurer hängt in den Seilen
Einen etwas anderen Ansatz für Robotnik am Bau verfolgt ein Forschungsteam der Universität Duisburg-Essen. Sie arbeiten an einem Seilroboter, der eigenständig Kalksandstein-Mauern errichtet und Zwischendecken einzieht. Am 16. Jänner wurde der in den Seilen hängende Maurer den Medien und lokalen Politgrößen präsentiert. Der Seilroboter soll die schwere körperliche Arbeit übernehmen und sie automatisiert und präzise ausführen. Innerhalb weniger Stunden soll er künftig eine Etage mauern, so die Forscher:innen. Steht die Mauer, soll der Roboter selbst das Werkzeug wechseln und Deckenelemente als Grundlage des nächsten Geschoßes platzieren. Entwickelt wurde die Technik am Lehrstuhl für Mechatronik unter Leitung von Dieter Schramm; das Institut für Baubetrieb und Baumanagement (IBB) um Alexander Malkwitz brachte seine Expertise rund um den Baubetrieb ein. „Die Planung der Baustelle als Fertigungsort wird anderen Regeln folgen“, betont Aileen Pfeil vom IBB. „In der Mensch-Maschine-Interaktion sowie in der Baustelleneinrichtung und -logistik werden wir neue Wege gehen müssen – ohne Menschen zu ersetzen. Vielmehr werden sie im Umgang mit der Technologie geschult und von körperlich schwerer Arbeit entlastet“, glaubt sie. Der Robotikforscher Tobias Bruckmann ergänzt: „Diesen Weg werden wir nicht alleine gehen. Von der Planung bis zur Ausführung müssen alle am Bau Beteiligten – aus Architektur, Planung, Baustoffherstellung und -lieferung bis hin zur automatisierten Errichtung von Bauwerken – die Transformation zur Digitalisierung der Branche mitgestalten.“ Dieser Thematik widmet sich ein Team unter der Leitung der TU München: Hier entwickeln die Robotiker:innen Softwaremodelle von Baurobotern. Zusammen mit Softwarebausteinen anderer Universitäten zur Koordination aller Akteur:innen erlauben diese den simulierten Blick in die automatisierte Baustelle der Zukunft, um dafür Prozesse, Bauverfahren und Systeme zu entwickeln und zu optimieren. Wie lange der Weg von der Simulation bis zur Baustelle ausfällt, bleibt letztlich abzuwarten.